Als ich vor einiger Zeit einen Artikel für das Online-Magazin Psylife über das Thema Sterbebegleitung schrieb, haderte ich mit mir. Denn meine Erkrankung nahm eine wichtige Rolle darin ein. Was aber bedeutet es, sich öffentlich so verletzlich zu präsentieren? Wäre es vielleicht geschickter gewesen, diesen Aspekt auszusparen?
Kranke Menschen werden unterschiedlich wahrgenommen, je nachdem, in welchem gesellschaftlichen Kontext sie sich bewegen. Unter Freuden und innerhalb der Familie wird ihnen im Idealfall Mitgefühl vermittelt. Außerhalb jedoch, beispielsweise im Berufsleben, sind sie eher ein Störfaktor und damit zugleich ein Risiko.
Lieber nicht
Welcher Arbeitgeber ist schon bereit, jemanden einzustellen, der nicht hundertprozentig funktioniert? Unzuverlässigkeit, schwindende Gewinne und kurzfristige Krankmeldungen sind nur einige der negativen Assoziationen, die mit chronisch Kranken verbunden werden.
Betroffene trauen sich deshalb nur selten, ihren gesundheitlichen Zustand an die große Glocke zu hängen. Um nicht unangenehm aufzufallen, geben sie sich zuweilen sogar mehr Mühe als ihre gesunden Kollegen, um sich mit guter Leistung als unentbehrlicher Teil des Teams ihren Platz in selbigem zu sichern.
Doch wäre Ehrlichkeit wirklich so gefährlich? Genau das habe ich mich damals gefragt, als ich kurz davor stand, meinen Makel öffentlich zu machen – öffentlicher als bisher. So ein Blog wie dieser ist nämlich in meinen Augen schon etwas anderes als namentlich in einem fachspezifischen Online-Magazin aufzutauchen und dadurch potentiellen Arbeitgebern von vornherein mit einem gewissen Nachgeschmack in Erinnerung zu bleiben.
Coming-out
Warum entschied ich mich dennoch für ein Coming-out? Ganz einfach: Weil ich es leid bin, mich zu verstecken. Und das war keineswegs eine neue Einsicht. Schon beim Bewerbungsgespräch für die Praktikumsstelle im Verlag ließ ich, weil ich es für fair hielt, alle Hüllen fallen und erklärte, dass ich chronisch krank bin. Ich stellte sogar den Worst Case dar: Wochenlange Inaktivität meinerseits – je nachdem, ob mein Körper mir die hauptsächlich sitzende Tätigkeit in Rechnung stellt oder nicht. Trotzdem wurde ich für die Stelle eingesetzt und das sogar über die eigentlich anberaumte Zeitspanne hinaus!
Und? Trat indessen der Worst Case ein? Nein! Denn indem ich mir selbst den Druck genommen habe, funktionieren zu müssen, konnte ich mich voll und ganz auf meine wunderbare Arbeit fokussieren. Und diese Arbeit, die Kollegen, alles drumherum taten mir so gut! So sehr, dass meine Erkrankung eigentlich nahezu in den Hintergrund geriert.
Bereue ich meine Entscheidung also? Ganz bestimmt nicht! Würde ich es wieder so handhaben? Immer! Obwohl mir natürlich klar ist, dass ein Praktikumsplatz etwas anderes als eine feste Stelle ist. Na, und wenn schon. Ich bin zwar nicht ganz funktional, doch ich weiß dafür wie niemand sonst, wie ich meine Ressourcen bestmöglich einsetzen kann, um eben nicht diesem gräulichen Klischee eines kranken Mitarbeiters zu entsprechen.
Und mal ganz ehrlich: Wäre meine Erkrankung nicht, käme ich vermutlich noch heute nicht auf Idee, meine Ziele zu verfolgen. Und wer weiß, ob ich überhaupt Ziele hätte.

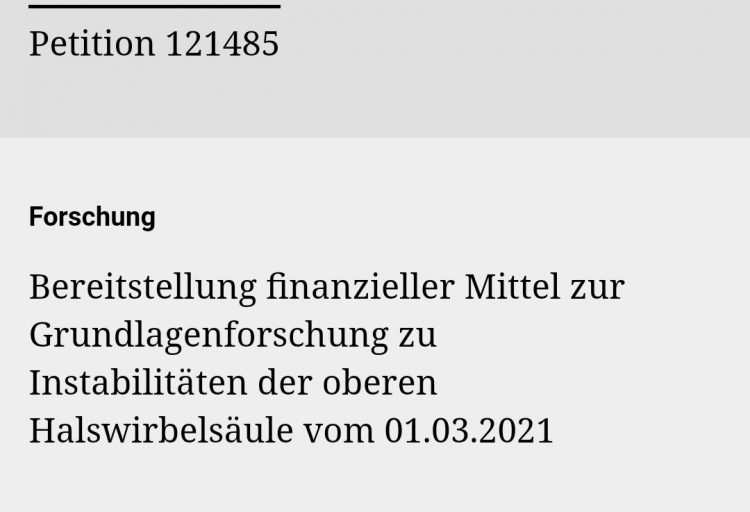


Leave a Reply