Es ist schon eine Weile her, als ich mit euch die Idee teilte, ein Instrument zu lernen. Die Frage war nur: Welches eigentlich? Denn mit instabilen Kopfgelenken hat man genaugenommen nur wenig Auswahl. Intensives Musizieren gilt genaugenommen sogar als Leistungssport, aus dem heraus sich zahlreiche spezifische Wehwehchen entwickeln können. Trotzdem kann ich mittlerweile sagen: Ich habe mein Instrument gefunden!
Männer sind Schweine
Wenn ich so darüber nachdenke: Als Kind hatte ich mit Musik und Musikinstrumenten gar nicht so viel am Hut. Ich mochte die Schlümpfe-CD und „Männer sind Schweine“ von Die Ärzte und das wars auch. Ich würde sagen, spätestens als ich eines schönen Heiligabends eine Kindergitarre bekam und diese postwendend auf den Boden schmiss, schloss sich die Tür zu dieser Welt für mich vollständig.
Aber halb so wild. Instrumente waren in meiner Vorstellung sowieso eher was für Kinder aus gesunden Familien. Denn es ist doch so: In gesunden Familien gibt es keine Probleme, also sind im Umkehrschluss haufenweise Zeit, Kraft und Geld da, sich stattdessen mit Herausforderungen einzudecken – so meine Überlegungen. Meine Familie hingegen war, naja…, nicht so ganz beisammen, könnte man sagen, weshalb Musikinstrumente da natürlich nicht hingehörten.
Ganz so stumpf denke ich jetzt natürlich nicht mehr, obwohl schon was Wahres dran ist, finde ich. Hätte ich (von meiner Erkrankung abgesehen) riesengroße Probleme, käme mir doch niemals in den Sinn, ein Musikinstrument lernen zu wollen. Wann denn auch? Irgendwo zwischen Streitereien, Geldsorgen und Gesprächen mit dem Kinderpsychologen?
Geh mir bloß weg
Etwas wollen, ist das eine; etwas tun, das ist ein ganz anderer Schuh. Dabei ist ein Sprung ins kalte Wasser doch letztendlich nur ein Sprung, es sei denn, man vertrödelt seine Zeit mit Zweifeln. Meine schlichte Devise: Einfach Anlauf nehmen und rein ins Angebot!
Gut war, dass ich immerhin schon wusste, was ich nicht wollte: Trompete, Gitarre, Geige (nix gut für den Hals), Dinge mit Tasten, alle Sorten von Flöten und so ziemlich alles, worauf man mit irgendwas draufschlagen muss. Viel blieb da nicht übrig. Trotzdem war es genug, mich ein bisschen in Entscheidungsnot zu manövrieren.
Mein erster Favorit war das Cello. Ich liebe den Klang dieses Instruments, ebenso wie den der Geige, doch damit wollte mein Hals natürlich nichts zu tun haben. Cello, dachte ich, spielt man aber praktischerweise im Sitzen. Sitzen ist zwar doof, aber besser als sich den Hals durch zwanghaftes Verbiegen noch mehr zu ruinieren. Also holte ich mir nach einer knappen Schnupperstunde in der Musikschule ein (gemietetes) Cello nach Hause und übte ein bisschen damit. Katastrophe, sag ich euch! Seither behaupte ich: Erst wenn man Cello spielt, fällt einem auf, wie giftig Sitzen tatsächlich ist. Ich hatte überall Schmerzen, Druck im Kopf und wollte dieses Ding nur noch loswerden. „Geh mir bloß weg!“, schimpfte ich deshalb immer, wenn ich daran vorbeilief, kurz davor, es zu zerhackstückeln. Und ja, das falsche Instrument kann Aggressionen freisetzen. 😀
Mein nächstes Opfer war das Saxophon. Obwohl ich Blasinstrumente nicht sonderlich spannend finde, reizte mich dieses Exemplar. Mein Lehrer war ein saucooler Typ und gab sich große Mühe, mir zu erklären, wie toll so ein Holzbläser sein kann (und ja, ein Saxophon ist ein Holzblasinstrument – wegen des Plättchens aus Holz, auf dem beim Pusten herumgekaut werden muss). Das Doofe ist allerdings: Ein Saxophon ist ziemlich schwer und auch wenn der untere Körper im Prinzip tun und lassen kann, was er will, bleibt die Kopfhaltung doch recht starr, schon allein wegen des Gurtes, den man tragen muss, damit das holde Stück nicht runterplumpst. Obendrein wird auch der Kiefer ganz schön beansprucht, weshalb für mich schnell klar war: Saxophon ist nix für Christinchen. Ich bin aber trotzdem sehr froh, einen Versuch gewagt zu haben.
Richard
In was ich mich letztendlich verliebt habe, seht ihr oben: Das ist Richard, mein Kontrabass, benannt nach meinem alten Physik- und Mathelehrer. Auch der war ziemlich bauchig und brummig, aber im Kern ein ganz lieber und kuscheliger Zeitgenosse – was aber nicht heißt, dass wir mal gekuschelt haben! Da hörts dann doch auf…
Kontrabassspielen ist allerdings wirklich kuschelig: nah, intensiv und warm. Hinzu kommt die grandiose Bewegungsfreiheit beim Spielen, denn nur die Beine müssen starr auf der Stelle stehen – der Rest darf sich schlängeln. Das immense Gewicht des Kontrabasses ist kein Problem, den man muss ihn ja nicht großartig tragen, sondern eher an sich abstützen. Im Gegenzug stützt auch Richard mich, wenn ich mal das Gefühl habe, instabil zu sein. Das fühlt sich an, als hätte ich einen Bodyguard oder großen Bruder, der liebevoll auf mich aufpasst.
Übrigens ist das gar nicht weit hergeholt. So laut, wie Richard brummen kann, würde jeder Einbrecher nach nur einem Schritt ins Haus sofort das Weite suchen. Für mich ist dieses Instrument aber nicht nur laut und kraftvoll, sondern auch beruhigend. Denn wenn er brummt, schwingt er, und wenn er schwingt, schwinge auch ich – hoch oder tief, je nachdem, wie ich Richard spiele. Und schwinge ich, schwingt auch mein Nervensystem. Die Wirkung ist… tja, dazu müssen mir ehrlich gesagt erst Worte einfallen.
Wenn gewünscht, halte ich euch darüber gern ein bisschen auf dem Laufenden. Wer weiß, vielleicht entpuppt sich Musik ja als wundersame Therapie für Menschen mit instabilen Kopfgelenken. Was das betrifft, stelle ich mich sehr gern als Versuchsperson zur Verfügung. 😉



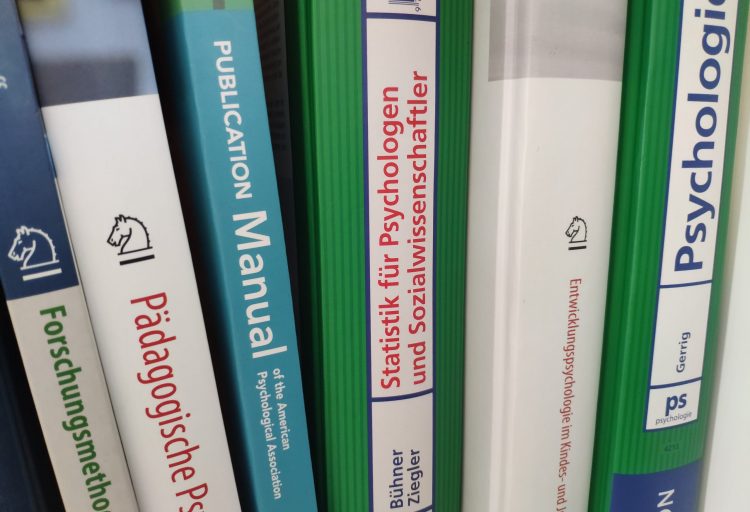
Antje
Ich stimme für „ja“ – gerne würde ich wissen wie es mit dir und dem Kontrabass weiter geht.
Ich selbst hatte eigentlich vor irgendwann wenn, die Kinder groß sind, Saxophon auszuprobieren, aber das war vor meiner Instabilität. Jetzt kann ich mir das gar nicht vorstellen.