Das Jahresende mit all seinen Feiertagen und Begegnungen hat schon eine besondere Art, uns mit uns selbst zu konfrontieren. Durch den Blick in den Spiegel, der sich in den Lebensläufen, Erfolgen und Geschichten anderer offenbart, beginnen wir zu zweifeln, uns zu vergleichen und manchmal auch zu verlieren – vor allem in Wohlfühlsrhetorik vom Fließband.
Zwischen Gehaltserhöhung und der nächsten Weltreise
Alle Jahre wieder sitzt man mit der wenigen Kraft, die einem als chronisch kranker Mensch zur Verfügung steht, am Tisch mit Menschen, die ausnahmslos funktionieren. Die mitten auf einer steilen Karriereleiter stehen und Sprosse für Sprosse an ihr emporsteigen, große Reisen planen, von spannenden Projekten berichten, oder sich in endlosen Fünf-Jahres-Plan-Monologen verlieren, als wären sie gegen die Ungewissheit auf Dauer immun.
Niemand sagt etwas Falsches. Niemand meint es böse. Und doch entsteht Druck: Warum schaffe ich das nicht?
Das große Bedauern
Und dann sind sie auch schon da: die Schuldgefühle, die rational keinen Sinn ergeben und sich trotzdem hartnäckig in uns ausbreiten. Und sich als Schwere im Brustkorb bemerkbar machen oder als Enge in der Kehle. Oder als dieses dumpfe Ziehen, wenn man zuhört und erkennt, dass man nichts Weltbewegendes zu einem lebhaften Gespräch beitragen kann. Bis all das schließlich zu tiefem Bedauern, nicht belastbar zu sein, metamorphosiert, und darüber, Gespräche unmerklich zu dämpfen, weil man langsamer denkt und früher aussteigt, mit noch mehr Bedauern darüber, Raum und Zeit einzunehmen wegen Grenzen, die niemand begreifen kann.
Und schließlich Bedauern über ein Leben, das von außen nicht als normal angesehen wird. Ein Leben mit Pausen, Ausfällen und Abbrüchen. Eines, das sich an Feiertagen nicht schön erzählen lässt.
Wohlfühlrhetorik macht mehr kaputt, als es nützt
Erwartet hier kein „Es ist okay, dass es euch so geht“. (Denn mal ehrlich: Fühlt es sich so an?!) Genau davon gibt es auf Instagram und Co. mehr als genug. Diese zu hohlen Floskeln verkommenen Absolutionen nehmen nichts ernst, sondern legen einen butterweichen Satz über etwas, das weh tut, um es schnell und einfach zu entmachten. Tag für Tag. Ohne Widerspruch, ohne Ringen oder Weiterdenken. Beruhigung auf Knopfdruck, und für mehr Klicks ohne Aufwand.
Doch psychologisch ist das problematisch, weil es emotionale Vermeidung fördert. Denn Gefühle, die stets und ständig beruhigt oder relativiert werden, werden nicht integriert, sondern bleiben unverarbeitet und sickern später wieder als Scham, innere Härte oder chronische Selbstabwertung an die Oberfläche. Forschung und klinische Erfahrung zeigen jedoch seit Jahrzehnten: Emotionen müssen benannt, ausgehalten und eingeordnet werden. Andernfalls organisieren sie sich unter der Oberfläche klammheimlich weiter (Chapman, 2025).
Hinzu kommt Invalidierung. Wenn komplexe innere Konflikte mit „ist schon okay“ beantwortet werden, fehlt etwas Entscheidendes: Anerkennung der Realität. Ohne diese Anerkennung kann kein Sinn entstehen, keine Neubewertung, keine echte Anpassung. Der Trostgedanke, der in diesen schnell erstellten Instagram- und Facebook-Slides steckt, mag zwar gut gemeint sein, doch in Wirklichkeit zielt er an einem entscheidenden Bedürfnis vorbei: Kohärenz. Das Gefühl, dass das eigene Erleben logisch ist im Kontext der eigenen Lebensumstände.
Und schließlich verhindert diese Wohlfühlrhetorik Selbstwirksamkeit. Wer nur beruhigt wird, lernt nicht, zwischen dem zu unterscheiden, was nicht geht, und dem, was vielleicht doch möglich wäre.
Vergleiche verstehen, anstatt sie wegzuwischen
Ein vorschnelles „ist schon okay“ kann uns somit eine ganze Menge Durchblick nehmen – zumindest wenn es, wie dieser Tage, wie am Fließband in die Mitte unserer Aufmerksamkeit gespült wird. Wenn es vielleicht genau in dem Moment, wenn wir uns besonders abgehängt fühlen, daherkommt und unser Erleben überbügelt, anstatt es begreif- und nutzbar zu machen.
Genau dann landet ein harmlos klingendes „Und was machst du so?“ fast zwangsläufig im Vergleich.
Wir vergleichen uns nicht aus Neid oder Missgunst. Wir vergleichen uns, weil unser Selbstverständnis Orientierung braucht. Hierzu schauen wir nach links und rechts, auf alles und jeden, der für als Bezugspunkte funktioniert: auf Gleichaltrige, Kolleginnen, alte Weggefährten, Menschen, mit denen wir uns irgendwie verwandt fühlen. An ihnen lesen wir ab, was als normal gilt, was erwartet wird und was scheinbar möglich ist. Und daraus wiederum basteln wir uns eine Art inneres Koordinatensystem, das uns sagt, wo in dieser Weltvorstellung wir stehen.
Das Problem ist nur: Vergleiche, ob nun zwischen gesunden und kranken Menschen oder generell, sind oft ein in die Irre führendes Bemühen – denn die Wenigsten starten mit den gleichen Voraussetzungen.
Spannend ist, dass chronisch Kranke das eigentlich auch sehr genau wissen, und trotzdem wirken Vergleiche wie sie eben wirken: Sie ordnen uns ein, setzen uns in Relation und lassen uns bei zu großen Abständen leise glauben, unsere Rückstände müssten doch irgendwie auszugleichen sein.
Und genau hier entsteht Schaden. Denn etwas Reales, Körperliches, Unverhandelbares rutscht langsam ins Persönliche. Und so werden aus Grenzen Selbstvorwürfe.

Offene Augen für neue Möglichkeiten
„Is schon okay“ hilft an dieser Stelle nicht, sondern hinsehen, auch wenn es zunächst unangenehm ist.
Denn nur so verschiebt sich der Maßstab – weg von der Frage, warum man nicht mithält, hin zu der ehrlicheren Frage, was hier eigentlich miteinander verglichen wird: Ein funktionierender Körper mit einem erschöpften. Planbarkeit mit Unsicherheit. Reserven mit Dauerknappheit. Das ist kein fairer Vergleich, und er war es nie. Wer diese verzerrte Selbstverortung einmal klar durchschaut, muss sich nicht länger an ihr abarbeiten. Sie mutig zu überprüfen führt zur Erkenntnis, dass hier nicht zu wenig Wille gegen zu viel Erfolg steht, sondern unterschiedliche Bedingungen nebeneinandergelegt werden, als wären sie gleich. Die Traurigkeit über diese Ungleichheit löst sich dadurch zwar nicht auf, aber das permanente Sich-selbst-Anklagen verschwindet nach und nach.
Weil Hinsehen ordnet. Es trennt das, was wirklich nicht geht, von dem, was nur unter falschen Erwartungen leidet. Es macht sichtbar, wo Kraft versickert, weil sie gegen Unpassendes eingesetzt wird, und wo sie vielleicht sinnvoller aufgehoben wäre. So wird Hinsehen nicht zum Weg tiefer ins Bedauern, sondern zeigt uns den Ausstieg daraus.
Das ist zwar nicht „okay“, aber es ist hilfreich.
Chapman, L. K. (2025, January 30). Understanding emotional avoidance and learning to tolerate uncomfortable feelings. Anxiety & Depression Association of America (ADAA).
https://adaa.org/learn-from-us/from-the-experts/blog-posts/consumer/understanding-emotional-avoidance



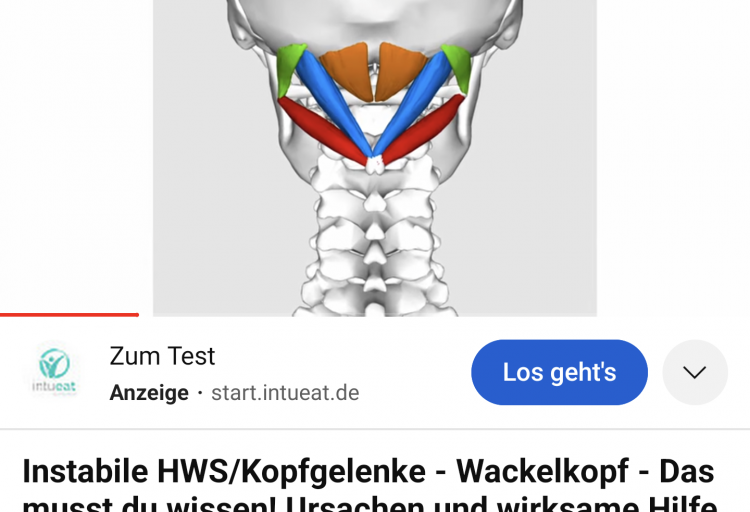
Leave a Reply