Die Zeit der exzessiven Arztbesuche ist längst vorbei. Nur hin und wieder, wenn der Enthusiasmus mich packt, statte ich ausgewählten Experten dennoch einen Besuch ab, um… naja… im Grunde noch immer, damit ich mich ernstgenommen fühle. Was diesmal rauskam – unauffälliger Spoiler: HSD – ist auch tatsächlich ein kleiner Meilenstein. Die Betonung liegt auf „klein“.
Zweitmeinung
Seit wir in der Pampa leben, überlege ich sehr genau, ob und bei wem ich mir Termine für die Begutachtung meiner Wehwehchen besorge. Fachärzte gibt’s hier schließlich nicht an jeder Straßenecke, und wenn ich schon kleine Weltreisen unternehme, dann muss auch was rausspringen. Nur kann ich das natürlich nicht voraussehen.
Das wiederum bedeutet, dass ich mich auf meinen Enthusiasmus verlassen muss. Knipst der sich an, meldet sich allerdings auch oft der Teil meines Hirns, in dem miese Erfahrungen gebunkert sind. „Lass es. Lass es einfach sein“, murrt dann eine Stimme und zeigt mir eingebrannte Bilder von erniedrigenden Gesprächen mit Ärzten. Neben Enthusiasmus braucht’s da oft noch einen anderen Ansporn, damit die Reizschwellen meiner Synapsen mich über die Autobahn befördern. Der Wunsch nach einer ärztlichen Zweitmeinung zum Beispiel.
Genstriptease
Mein erster, wie so oft selbst in die Wege geleiteter Besuch bei einem Humangenetiker war irgendwie unbefriedigend, auch wenn ich hinterher eine gewisse Erleichterung mit nach Hause nehmen durfte. Obwohl man ein Bild von mir in humangenetischen Fachbüchern unter dem Krankheitsbild Marfan Syndrom abdrucken könnte (sagte damals der Onkel Doktor), präsentiert sich diese Erkrankung zum Glück nicht in meinen Genen. Ebensowenig die Ehlers-Danlos-Syndrome (EDS). Trotzdem blieb bis jetzt eine gewisse Unsicherheit in mir zurück, da ich mich in Bezug auf den hypermobilen Typus (hEDS; für den es keinen Bluttest gibt) nicht gründlich genug unter die Lupe genommen fühlte
Ich bin hypermobil. Ich habe rätselhafte Beschwerden. Und hEDS geht den Ärzten gern mal durch die Lappen. Deshalb mein Wunsch nach einer weiteren Einschätzung.
Jetzt frage ich mich allerdings, ob ich von meinem ersten Besuch bei einem Genetiker überhaupt schon berichtet habe? Sagt mal an, ich hole das gern nach.
Immerhin eine Nette
Als ich in der Praxis ankam, hatte ich gemischte Gefühle – irgendwas zwischen Hoffnung und vorläufigem Frust. Zumindest musste ich nicht lange warten. Eine zierliche Ärztin bat mich in ihr Untersuchungszimmer und ließ mich denken: „Immerhin eine Nette.“
Der Raum, in dem wir saßen, hatte imposante Ausmaße. Und riesige Fenster, durch die man viel Grün sah und Vögel beobachten konnte. Im Kontrast dazu meine Leidensgeschichte, die der Genetikerin sichtlich schwer im Magen lag, vor allem mein laienhafter Verdacht, am Ehlers-Danlos-Syndrom erkrankt zu sein.
„Hmm…“, hörte ich ihr gedankenversunkenes Brummen, während sie sich um mich herumbewegte wie eine Katze, die Punkte meines Beighton-Scores zusammenzählte und mir Fragen stellte. (Hier ein Einblick, wie sowas auf Papier aussieht.) Zum Beispiel, ob meine Gelenke teilweise oder vollständig auskugeln.
„Ja“, sagte ich, „meine Knie und meine Kiefergelenke.“ Dumm gelaufen, denn die richtige Antwort wäre Schulter- und Hüftgelenke gewesen. Von „richtig“ in diesem Kontext zu reden, ist natürlich Unsinn. Aber warum ploppende Knie nicht ebenfalls ein beachtenswertes Indiz für hEDS sind, wunderte mich schon ein bisschen.
Raus aus dem Spektrum
Die Ärztin war sich jedenfalls schnell sicher: kein hEDS. Zum einen weil ich es nicht geschafft habe, bei durchgedrückten Knien mit meinen Händen den Boden zu berühren – woraus geschlussfolgert wurde, dass ich stabil genug sein muss. (Ich persönlich nenne das steif und sehe da einen gewissen Unterschied). Obendrein fehlt die Familienanamnese, was bedeutet, dass mir ein Punkt fehlt weil meine Eltern noch nie bei einem Genetiker waren, um ihre Mobilität beurteilen zu lassen. Ach, und meine Narben sind alle unauffällig.
Trotzdem erkannte die Genetikerin, dass ich aus dem gewöhnlichen Spektrum etwas herausrage. hEDS fiel nun aber als Begründung aus.
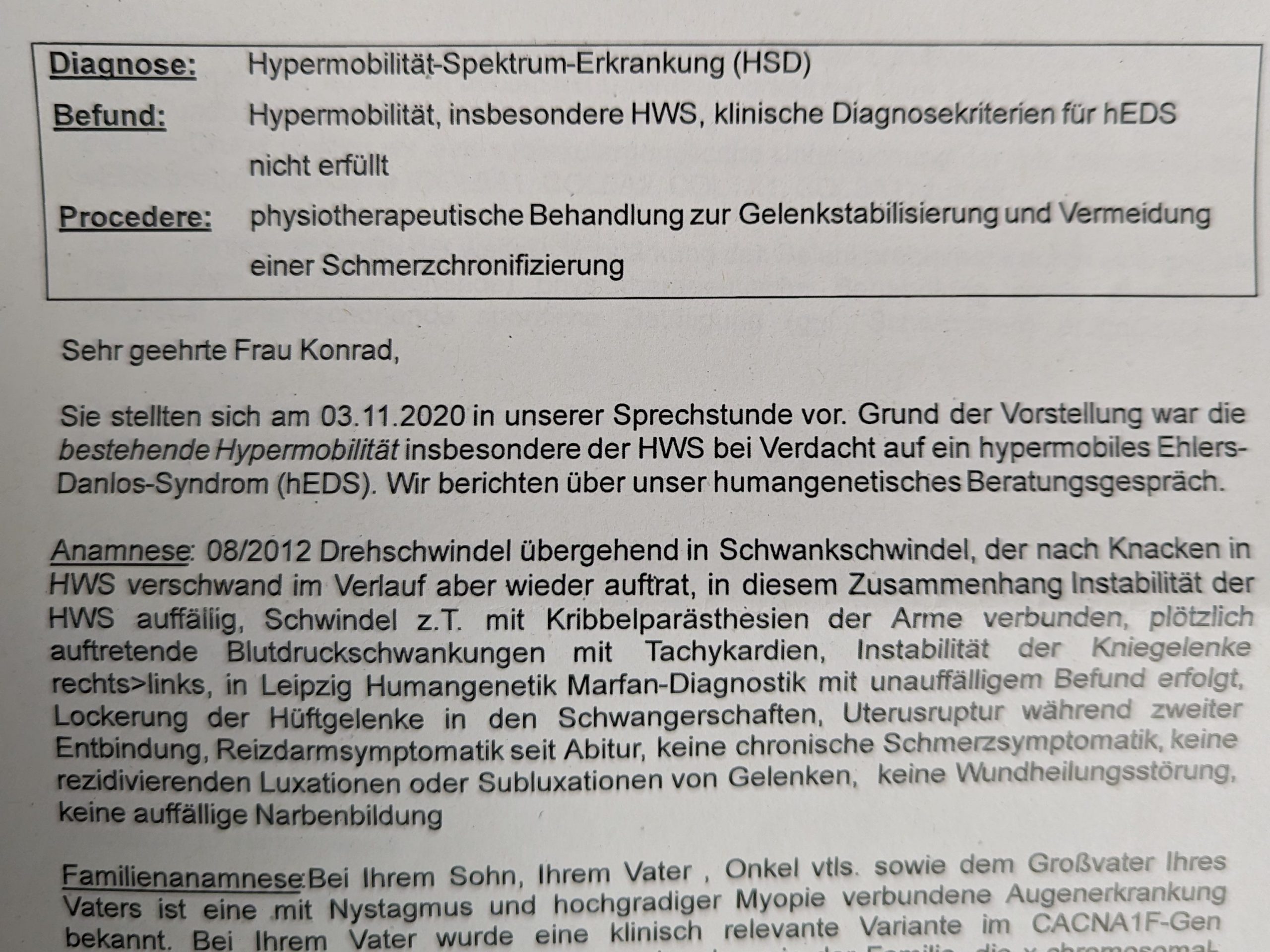
HSD und hEDS
Spektrum ist eigentlich das perfekte Stichwort, um mal den Unterschied zwischen hEDS und HSD zu beleuchten. Im Grunde lässt sich dazu sagen: Es gibt eigentlich keinen.
HSD und hEDS liegen auf der Bandbreite der Bindegewebserkrankungen auf einer Linie und teilen sich sehr viele Eigenschaften. Das Lehrbuch beschreibt es zwar in etwa so: Ganz links stehen die Personen mit einer gewissen Überbeweglichkeit ohne Symptome, ganz rechts diejenigen mit starken Symptomen (hEDS) und in der Mitte HSD-Betroffene. Die exakte Zuordnung verlangt zudem eine lokale Eingrenzung der von Überbeweglichkeit betroffen Körperstellen.
Nun gibt es da aber ein paar Probleme. Zum Beispiel ist solch eine Platzierung anhand der Symptomschwere keineswegs trennscharf und unterliegt somit zum Großteil der subjektiven Wahrnehmung des konsultierten Arztes sowie dem Empfinden und der Art der Offenlegung des Patienten. Zum anderen ist Hypermobilität gar nicht so leicht zu beurteilen, wie man denkt.
Dass ich mich nicht bücken konnte, hieß nicht, dass ich generell nicht konnte. Sondern dass mein Körper an bestimmten Stellen Schutzspasmen eingerichtet hat, die mich als hypermobiler Mensch vor Verletzungen beschützen. Manche Ärzte kennen den Unterschied zwischen steif und stabil. Andere eben nicht. Die Diagnose fällt entsprechend aus.
Aus diesem Grund ist eine Einteilung hypermobiler Menschen in das eine oder andere Krankheitsbild nahezu unmöglich, vielleicht sogar nutzlos, denke ich. Aber schaut selbst
Foto: OpenClipart-Vectors – pixabay.com
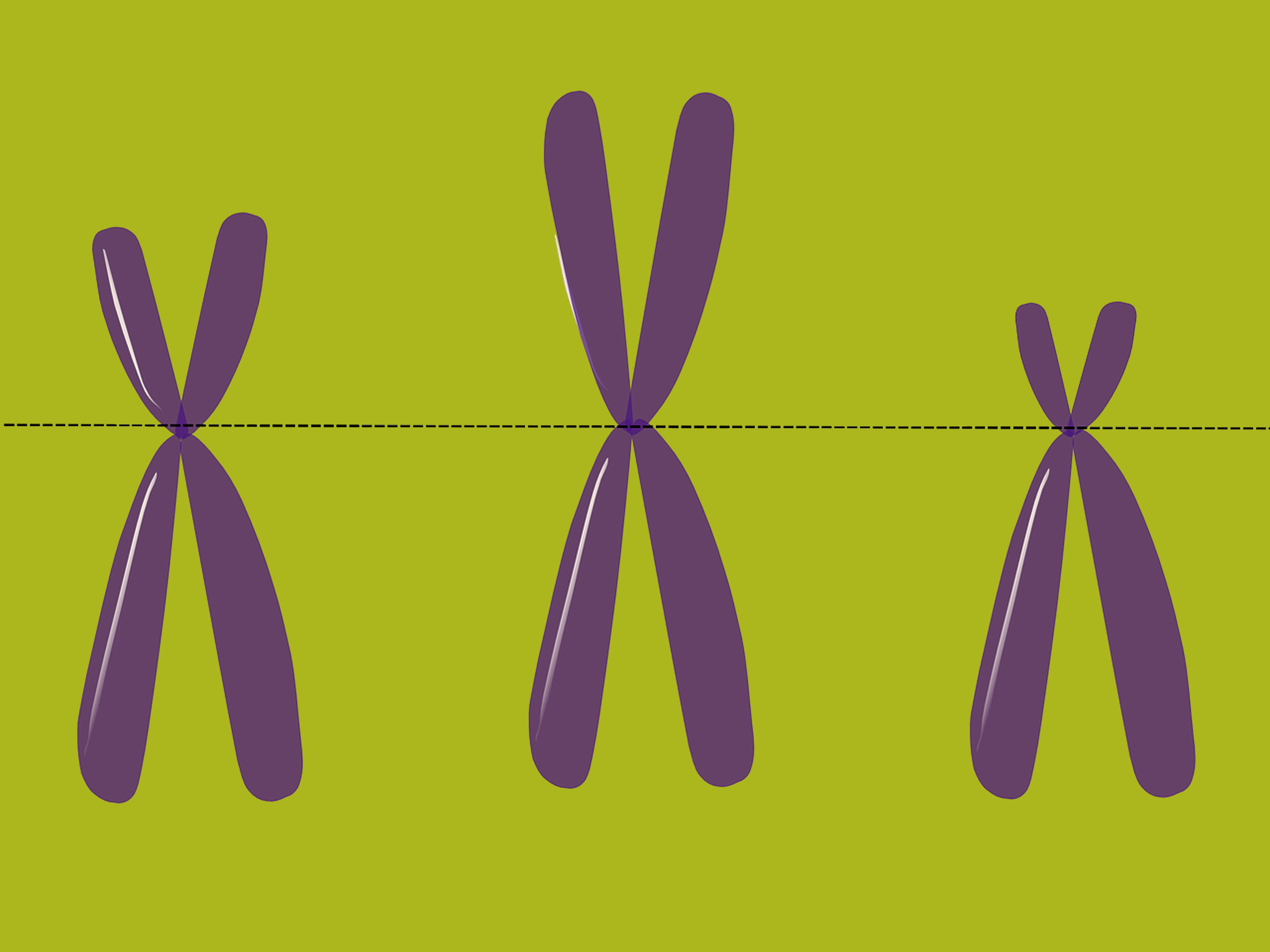



Leave a Reply