Alle reden, wenn es um CCI geht, immer vom „schiefen Atlas“ oder dem „zu lockeren Band“. Aber das ist gar nicht der Knackpunkt (ha-ha). CCI entsteht nicht, weil ein Wirbel „verrutscht“, sondern weil ein Regulationssystem kippt, das Ecken und Kanten normalerweise ganz locker wegsteckt. Darum haben manche mit denselben Befunden null Beschwerden und andere crashen komplett.
„Verrutschte“ Wirbel ohne Symptome
Soll ich euch was sagen? Ein „schiefer“ Atlas oder andere „verrutschte“ Halswirbel sind nicht automatisch gefährlich. Millionen Menschen haben sie – völlig symptomfrei (Panjabi, 1992; Brinjikji et al., 2015).
Zwar ist die Halswirbelsäule das Nadelöhr des Körpers, durch das Strukturen laufen, die das Gehirn versorgen und solche, mit denen das Gehirn den Körper steuert. Doch Zufallsbefunde zeigen immer wieder: Die Position der Wirbel allein macht nicht automatisch Beschwerden.

Anatomie sieht kleine Katastrophen vor
Die Anatomie erwartet Variation – sie gehört einfach dazu. Deshalb können Menschen selbst mit „katastrophaler“ Wirbelsäulenstruktur völlig beschwerdefrei leben. Struktur ist nämlich nicht gleich Funktion, und schon gar nicht gleich Regulation. Und regulieren kann unser Körper richtig gut. Dafür hat er etliche clevere Mechanismen entwickelt (Ghori et al., 2012).
Propriozeptive Redundanz
Ein wichtiger Mechanismus ist die propriozeptive Redundanz. Redundanz bedeutet Überfluss oder Wiederholung, und meint in diesem Zusammenhang: Mehrere überlappende Rezeptorsysteme versorgen den Körper gleichzeitig mit Positions- und Bewegungsinformationen. Dieses „Zuviel“ ist ziemlich wichtig, da es immer wieder vorkommt, dass Rezeptoren mal blau machen. Durch den Überfluss können diese Ausfälle jedoch kompensiert werden.
Ligamentäre Redundanz
Redundanzen finden sich auch woanders in den Kopfgelenken, und zwar in Form vieler Bänder, die ähnliche Aufgaben erfüllen – wie beispielsweise den Kopf zu stabilisieren. Bänder sind viskoelastisch, passen sich also an dauerhafte Spannung an und erzeugen einen Grundtonus (Pre-Stress). Ein dauerhaft „verrutschter“ Wirbel kann dadurch völlig symptomlos bleiben.
Gelenkflächen
Auch die Gelenkflächen selbst stabilisieren: Im Bereich C0–C1 sind sie konvex/konkav geformt, wie eine Schale: selbstzentrierend und kippsicher. Zwischen C1–C2 sind sie doppelt konvex, wie zwei Kurven, die sauber ineinander gleiten; ideal für stabil geführte Rotation.
Uncovertebralgelenke
Die Uncovertebralgelenke wirken wie seitliche Führungsschienen der unteren Halswirbelsäule. Wenn in den Kopfgelenken etwas lax ist, übernimmt der Bereich darunter automatisch mehr Führung.
Tiefe Nackenmuskulatur und neuromuskuläre Kontrolle:
Die tiefen Flexoren, Extensoren und Suboccipitalmuskeln stabilisieren segmentgenau, in Millisekunden und feinmotorisch. Sie zentrieren Gelenke, bremsen Mikrobewegungen und gleichen ligamentäre Schwächen aktiv aus. Sie sind der wichtigste dynamische Stabilisator der Kopfgelenke.
Myodurale Brücke (Enix et al., 2014)
Diese Struktur verbindet die suboccipitalen Muskeln mit der Dura. Sie reguliert Duraspannung, beeinflusst Liquorfluss und schützt den Hirnstamm vor mechanischem Stress. Ein stiller, aber essenzieller Kompensator.
Faszien
Faszien lenken Kräfte dreidimensional um, nehmen Spannung auf, verteilen Lasten und verhindern, dass einzelne Strukturen isoliert überlastet werden. Besonders im oberen Nacken wirken sie wie ein feinmechanischer Dämpfer.
Autonomes Nervensystem (ANS)
Der Vagusnerv, der Hirnstamm und die zervikale Propriozeption bilden zusammen ein neurophysiologisches Schutzsystem. Sie regulieren Muskeltonus, dämpfen überschießende Bewegungen und stabilisieren Reflexketten. Überlastet das ANS, entsteht Instabilitätsgefühl – aber nicht unbedingt Instabilität
Visuelles und vestibuläres System
Die Augen und das Gleichgewichtssystem stabilisieren permanent die Kopfhaltung. Starke visuelle Kopplung kann mechanische Schwächen überlagern; vestibuläre Reflexe stabilisieren Kopfbewegungen, selbst wenn die HWS strukturell Variation zeigt.
Bewegungsstrategien
Der Körper entwickelt automatisch alternative Bewegungsprogramme, wenn ein Segment schwächelt – zum Beispiel weniger Rotation, mehr Thoraxrotation, mehr Kontrolle durch Atmung oder Muskelvorspannung. Das geschieht unbewusst und schützt.
Szenario: Lig. alare lax
Hier mal ein grobes Beispiel, damit sichtbar wird, wie diese ganzen Teammitglieder zusammenarbeiten. Ist das Ligamentum alare lax, wäre theoretisch die Begrenzung der Rotation und Seitneigung zwischen C1 und C2 abgeschwächt. Praktisch aber verteilt sich die Last sofort auf andere Bänder. Parallel dazu spannen sich die Kapseln der Facettengelenke (stark unterschätzte Stabilisatoren) stärker an und die suboccipitale Muskulatur erhöht ihren Tonus, um mit aktiver Stabilisierung die passive Stabilität zu unterstützen. Zudem sichern Uncovertebralgelenke seitliche Bewegungen ab und das Nervensystem kreiert neue Bewegungsstrategien, um beispielsweise das Verletzungsrisiko zu senken. Die Myoduralbrücke wiederum entstresst den Hirnstamm, Faszien lenken Kräfte um und die Propriozeption hilft beim Korrigieren potenziell schädlicher Bewegungen.
Solange diese und andere Regulationssysteme funktionieren, bleibt die Gesamtfunktion der Kopfgelenke stabil – auch wenn ein einzelnes Band lax ist.
Regulation ist Teamarbeit
Regulation ist also Teamarbeit. Somit hängt Stabilität nie von einem einzelnen Band ab, zumal Bänder auch gar nicht die Hauptstabilisatoren unserer Kopfgelenke sind. Laut Panjabi (1992) sind sie in neutraler Position vor allem Sensoren, keine Stützen.
Die Hauptrollen übernehmen eher:
- Gelenkflächen (Platz 1),
- Muskeln (Platz 2) und
- Gelenkkapseln (Platz 3).
Und dieses gesamte System verzeiht Asymmetrien, solange es genug Teamkollegen gibt, die funktionsunfähige Bereiche mittragen.
Kleine Einordnung
Natürlich ist ein Fass auch einmal voll. Weil entweder ein Schaden so verheerend ist, dass Regulation gar nichts mehr bringt – oder weil zu viele Regulationssysteme überfordert sind. So oder so: Ist eine bestimmte Grenze überschritten, kippt das System, Symptome entstehen und das Leben dreht sich auf den Kopf. Und genau diese Symptome braucht es letztlich, damit auffällige Bilder der Kopfgelenke überhaupt zu einer CCI-Diagnose werden können. Und ja, oft sind diese Symptome höllisch.
Die Behandlungsmöglichkeiten verteilen sich nun auf einer großen Spannweite – von sanft-konservativ bis brutal-invasiv. Und nun hat man die Qual der Wahl bzw. müssen Spezialisten entscheiden, ob im Einzelfall das Ende des Spektrums erreicht sein könnte.
Meine Intention, wenn ich hier Wissensschnipsel verbreite: Dass immer weniger Betroffenen nur noch eine allerletzte Option bleibt, weil sie durch besseres Verständnis über die Entstehung von CCI bessere Entscheidungen treffen können. Was also diesen Beitrag betrifft, möchte ich euch soweit auf (meinen) Stand bringen, dass ihr euch eine Frage stellt, die mir selbst seit einiger Zeit auf der Seele brennt: Wie zuverlässig spiegeln selbst die höllischsten Symptome den tatsächlichen Schweregrad einer CCI wider?
Nicht nur im Hinblick auf eine Operation – sondern im Hinblick auf jede Therapie überhaupt: ob sie sinnvoll ist, machbar ist und vom System überhaupt angenommen werden kann.
Um es überspitzt ausdrücken – Worst Case Genickbruch: Hier ist die Sache ganz eindeutig. Die Bildgebung zeigt eine klare strukturelle Katastrophe, die Symptomatik ist eine Katastrophe (und bewegt sich außerhalb des Einflusses von Tagesform und Co) und die Therapie ist alternativlos.
Aber CCI bewegt sich in einem sehr breiten Spektrum. Und Messgrößen, die weder normiert noch standardisiert sind, sollen gemeinsam mit subjektiven Symptomen über die Therapie entscheiden – obwohl… Diesen Satz kann ich erst weiter unten beenden, denn er setzt etwas mehr voraus.
Denn wisst ihr, wer der überhaupt bestimmt, ob und wie gut die oben beschriebenen Regulationssysteme funktionieren. Trommelwirbel: Es ist das Nervensystem.
Das Nervensystem ist der Chef
Ich wiederhole mich zwar, aber ich wiederhole mich für den guten Zweck: Als ich mitten im Zombie-Zustand hing, fühlte es sich an, als würde mein Kopf jeden Moment herunterfallen. Schwindel, Druck, Migräne, Panik, innere Vibrationen, Herzrasen beim Kauen, optische Störungen, Derealisation – ein Körper, der komplett außer Kontrolle geraten war. Natürlich glaubte ich damals, das müsse alles von meiner Halswirbelsäule kommen. Was auch sonst? Sie war voller Blockaden, überbeweglich, das Upright-MRT zeigte Auffälligkeiten…
Aber nun weiß ich: Diese Auffälligkeiten waren ebenfalls Symptome. Und zwar Symptome eines Systemzusammenbruchs. Dieses System besteht – wie Panjabi schon 1992 beschrieben hat – aus drei Teilen:
- dem passiven System (Bänder, Knochen, Gelenke)
- dem aktiven System (Muskeln, Faszien, myodurale Brücke)
- dem neuralen System (Hirnstamm, Propriozeption, Reflexe, autonomes Nervensystem)
Das dritte System ist von allen der Chef, und damit derjenige, der entscheidet, ob der Nacken sich stabil anfühlt oder wie ein Sturz in den Abgrund. Und nicht nur das: Er ist auch derjenige, der all die oben genannten Kompensatoren steuert.

Mein Missverständnis
Klar dachte auch ich lange: „Lauter Wirbel sind verrutscht. Aber wenn ich sie wieder richten lasse und fleißig Muskelaufbau betreibe, wird alles besser.“ Also lief ich Therapien hinterher wie ein Zombie, der irgendwo ein Stück Hoffnung riecht. Alles ausprobiert. Alles gehofft. Alles verschlimmert. Rückblickend klar: Jede Therapie war ein neuer Stressreiz, und ein überflutetes Nervensystem kann keinen einzigen Stressreiz tolerieren – egal wie gut gemeint. Meine persönliche Erkenntnis:
Mein Körper war nicht kaputt. Mein System war überlastet. Darum hat nichts mehr funktioniert. Darum hat jede Behandlung nur gekostet. Darum ist jede kleinste Kleinigkeit eskaliert.
Der Wendepunkt: Ich begann, meine Regulation zu regulieren
Heute geht es mir gut. Aber nicht, weil mein Atlas plötzlich „artig“ geworden wäre oder weil ich auf magische Weise nicht mehr überbeweglich bin. Sondern weil ich mich dem Chef meines Körpers zugewandt habe und ihm gab, was er brauchte, um wieder zu funktionieren. Sicherheit.
Und das klappte!
Warum?
Weil Stabilität nicht von den Bändern kommt. Sondern von der Qualität der neuromuskulären Steuerung.
Von der Art, wie das Nervensystem Spannung organisiert. Von der Fähigkeit, Bewegungen zu koordinieren. Von der Regulation des autonomen Systems. Von sensorischer Integration.
Also nochmal: Von Sicherheit.
Macht Schokolade Lust auf Chips – oder andersrum?
Das hätte jetzt ein wundervoller Abschluss werden können, oder? Aber ich rieche, dass euch noch etwas auf der Seele brennt. Ich bin mal so frei und formuliere es aus. Ihr denkt womöglich in etwa das:
„Ich habe gelernt: Wenn Wirbel ‚verrutschen‘, dann reizen sie das Nervensystem und dann geht alles nur noch durcheinander. Wie kann es dann möglich sein, mit Hilfe des Nervensystems zu heilen?
Und da ist sie wieder, unsere geliebte Entweder-oder-Brille:
- Entweder Psyche oder Körper.
- Entweder Chips oder Schokolade.
- Entweder macht Instabilität das Nervensystem kaputt oder das Nervensystem macht instabil.
Und das wiederum führt zu der Frage: Macht Schokolade Lust auf Chips? Oder andersrum? Und spielt das überhaupt eine Rolle?

Man muss das Gehirn verstehen – denn es arbeitet anders, als man denkt
Bevor wir jetzt in die Frage einsteigen, ob Instabilität das Nervensystem verrückt macht oder das Nervensystem Instabilität erzeugt, müssen wir einmal verstehen, wie das Gehirn überhaupt arbeitet. Denn das Gehirn reagiert nicht auf das, was JETZT passiert – sondern auf das, was es erwartet (Barrett, 2017).
Muss man sich so vorstellen:
In unserem Gehirn existiert ein internes Modell unseres Körpers in der Welt. Dieses Modell baut Vorhersagen darüber, wie sich der Körper in bestimmten Situationen anfühlen sollte, was wir wahrnehmen sollten und welche Handlungen sinnvoll wären. Erst danach kommen die tatsächlichen Reize aus der Umwelt oben drauf – und das Gehirn vergleicht seine Vorhersage mit der Realität.
Die Differenz daraus ist der sogenannte Prediction Error. Ist dieser Fehler klein, läuft alles reibungslos, das Modell passt und das System freut sich, weil es durch seine gute Vorhersagte Energie sparen konnte. Ist der Fehler groß, muss das Modell korrigiert werden – und das kostet Kraft, erzeugt Spannung und Stress.
Wo die Vorhersagen entstehen und was damit passiert
Diese Vorhersagen entstehen im Default Mode Network. Das Salience Network entscheidet anschließend, welche Signale relevant sind, wie gravierend ein Prediction Error bewertet wird und wie der Körper darauf reagiert. Beide Netzwerke sind eng mit den Bereichen im Gehirn verknüpft, in denen Körperempfindungen, Emotionen, Schmerz und autonome Prozesse zusammenlaufen.
Wie Vorhersagen bei Wackelhälsen aussehen
Beim „Wackelhals“ passiert Folgendes: Das Gehirn erwartet aufgrund jahrelanger Erfahrung eine bestimmte, stabile Kopfhaltung und eine gewisse Bewegungsqualität. Die HWS-Sensoren melden jedoch ein anderes, schwankendes Bild. Dadurch entsteht ein massiver Prediction Error. Die Simulationen im Gehirn müssen ständig neu berechnet werden, und das verbraucht Energie, führt zu Schutzspannung und macht das Gesamtsystem empfindlicher.
Die Folge ist ein typisches Symptomcluster: Schwindel, Benommenheit, Schwankgefühl, das Gefühl, der Kopf sei zu schwer, Nackenspannung, Kopfdruck, visuelle Störungen und Überempfindlichkeiten.
Das Salience Network dreht hoch, weil diese Signale körpernah, schwer zu ignorieren und potenziell „gefährlich“ wirken – schließlich hat all das irgendwie mit dem Kopf zu tun, und der ist ja nicht ganz unwichtig. Der Prediction Error erhält somit ein sehr hohes Gewicht.
In der Konsequenz richtet das Salience Network die Aufmerksamkeit immer stärker auf den Nacken, erhöht die Grundanspannung und aktiviert dauerhaft den Sympathikus. Das äußert sich als innere Unruhe, starkes Alarmgefühl, hyperfokussierte Körperwahrnehmung („Ich spüre jede Kleinigkeit“) und schnellere Erschöpfung. Das Ganze ist nicht psychosomatisch – es ist ein Gehirn, das mit unsicheren Signalen aus der HWS arbeiten muss und Schutzmaßnahmen ergreift.
Psychodiagnosen haben hier ihren Ursprung
Wenn das Default Mode Network immer wieder Simulationen erzeugt, die aufgrund widersprüchlicher HWS-Signale zusammenbrechen, gerät die Allostase unter Druck. Das System geht in eine defensive Überlebensstrategie: Rückzug, Reizvermeidung, hohe Alarmbereitschaft. Emotional übersetzt sich das in Angst, Unsicherheit, Hilflosigkeit oder Gereiztheit.
Es ist also nicht ganz so einfach, wie viele Ärzte uns das weismachen wollen: „Du hast Angst, deshalb ist dein Nacken so.“
Sondern: „Dein Nacken liefert chaotische Informationen, und dein Gehirn konstruiert daraus eine bedrohliche Realität.“
Aber genau das lässt sich therapeutisch nutzen.
Ein Hoffnungsschimmer inmitten des Chaos
Ich halte fest: Das Gehirn reagiert nicht auf das, was tatsächlich passiert, sondern auf das, was es basierend auf Vorhersagen erwartet. Diese Vorhersagen sind dazu da, ohne große Rechenleistung möglichst effizient auf äußere und innere Reize reagieren zu können, denn das spart Energie. (Kennt wir alle: Gute Vorbereitung ist alles.) Die Trefferquote dieser Vorhersagen wird für zukünftige ähnliche Gegebenheiten und Situationen stets bewertet und bei großen Abweichungen angepasst. Da dies bei Wackelhälse jedoch wie der Versuch ist, einen Rohrbruch mit einem Taschentuch in Schach zu halten, steuert das Gehirn dagegen, indem es versucht, durch höhere Wachsamkeit zuverlässigere Prognosen zu erzeugen. Doch das hat etliche Nachteile: Signale werden überinterpretiert oder gänzlich falsch bewertet. Basierend darauf kommt es zur Symptomverschlechterung.
Das Gehirn austricksen
Um aus diesem Prozess auszusteigen, dachte ich mir, müssen die Regeln des Systems umgangen werden. Anders formuliert: Das System müsste genau an der Stelle beeinflusst werden, an der es sich festgefahren hat: bei der Bedrohungsbewertung. Das bedeutet: Das Gehirn braucht Informationen über die HWS, die keinerlei Bedrohung bedeuten und gleichzeitig nicht überprüfbar sind – also Zukunftssimulationen in Form interner Modelle, die nicht durch aktuelle nocizeptive oder propriozeptive Störsignale sabotiert werden können. Denn die Zukunft ist noch nicht eingetreten – also kann das Gehirn sie nicht als falsch „markieren“. Wozu? Damit ein regulativer Freiraum ohne Prediction Errors entsteht. In diesem Freiraum fährt das Salience Network herunter, der Sympathikus beruhigt sich und das System wird wieder aufnahmefähig für Therapie, Bewegung und Reorganisation. Am Ende kehrt die Allostase zurück – weil Simulation und erlebte Realität wieder übereinstimmen.
Happy Ende. Jedenfalls für mich.
All das macht den nächsten Abschnitt irgendwie nutzlos, aber ich habs ja nun versprochen…
Der Albtraum kommt über zwei Wege
Es gibt bei CCI im Grunde zwei Wege, wie der ganze Albtraum entstehen kann – und beide führen am Ende in denselben Teufelskreis. Der erste Weg beginnt „unten“, bei der Mechanik. Wird ein Band lax, ein Segment überbeweglich oder die Kopfgelenke nach Trauma, Hypermobilität oder Entzündung instabil, dann stimmt die Propriozeption nicht mehr. Die Kopfgelenke liefern dem Gehirnstamm normalerweise extrem präzise Daten, doch fällt diese Präzision weg, wertet das Nervensystem diesen Zustand als Gefahr. Der Hirnstamm geht in Alarmmodus, das autonome Nervensystem schaltet hoch, die Muskulatur versucht mit Schutzspannung das Desaster abzufangen, die tiefen Stabilisatoren schalten ab, die Bewegungsqualität verschlechtert sich – und genau dadurch werden die Segmente noch instabiler. Die Instabilität erzeugt Nervensystem-Chaos, und dieses Chaos macht die Instabilität schlimmer.
Der zweite Weg beginnt „oben“: im Nervensystem selbst. Chronischer Stress, Angst, Trauma, Schlafmangel, sensorische Überforderung, Dysautonomie oder zentrale Sensitivierung können das System so empfindlich machen, dass es selbst völlig normale Bewegungen und Signale aus dem Nacken als Gefahr interpretiert. Dadurch verändert das Nervensystem die Motorik: Die tiefen Muskeln werden schlechter angesteuert, die großen Oberflächenmuskeln übernehmen und verspannen, die Atmung kippt in Brust- oder Stressmuster, die Bewegungsqualität wird unruhig – und plötzlich fühlt sich ein eigentlich stabiles Segment instabil an. Das Nervensystem hat durch Fehlsteuerung echte funktionelle Instabilität erzeugt, ohne dass ein Band gerissen oder ein Gelenk „verrutscht“ wäre. Und wenn die Führung schlechter wird, wackelt die Mechanik tatsächlich, wodurch das Nervensystem noch nervöser reagiert. Auch hier: Fehlsteuerung erzeugt Instabilität, Instabilität verstärkt Fehlsteuerung.
So oder so: Man kann oben einsteigen oder unten – am Ende landet man im gleichen Kreislauf aus schlechter Propriozeption, überreiztem Hirnstamm, autonomen Turbulenzen und Verlust von Stabilität.
Reminder und Wurst
Erinnert ihr euch an das Modell von Wood und Kollegen (2015)? Es beschreibt, was passiert, wenn nicht nur ein einzelnes Element im System schwächelt, sondern das gesamte Netzwerk aus Bändern, Faszien, Propriozeption und Hirnstamm gleichzeitig unter Stress gerät.
Der Auslöser in diesem Modell ist eine starke Immunaktivierung, die das Bindegewebe angreift und die feinen Strukturen des Kopfgelenkbereichs verletzlicher macht. Dadurch wird der Hirnstamm empfindlicher, seine autonomen Zentren überreagieren, die Propriozeption verschlechtert sich und die Muskulatur verliert an Feinsteuerung.
Mechanik und Neurophysiologie kippen hier also nicht nacheinander, sondern gleichzeitig. Das Ergebnis kennen wir: Es fühlt sich dann an, als würde jemand das Fundament und die Alarmanlage des Hauses zur gleichen Zeit zerstören: Die Stabilität sinkt, die Schutzsysteme überdrehen, und das Fass ist voll.
Schokolade oder Chips – alles Wurst: Das Nervensystem bleibt ein wichtiger Joker, der zum Beispiel über die Psyche bedient werden kann. Denn es ist – nochmal Trommelwirbel – neuroplastisch. Haben wir weiter oben gesehen, zeigt sich aber auch überall sonst:
Das Nervensystem ist lernfähig
Wenn ich mir den Review von Louw & Kollegen (2011) so anschaue, dann steht da im Grunde genau das wissenschaftlich drin, was ich in meinem Blog immer wieder runterbete – nur halt in Fachchinesisch:
Diese schlauen Köpfe werteten acht Studien mit insgesamt 401 Personen mit chronischen muskuloskelettalen Schmerzen aus – alles Untersuchungen, bei denen die Probanden nicht einfach nur klassische „Rücken- / HWS-Aufklärung“ a la „Bandscheibe kaputt, Gelenk abgenutzt“ bekam, sondern Neuroscience Education. Also: Unterricht darüber, wie das Nervensystem Schmerz macht – mit Themen wie periphere und zentrale Sensibilisierung, Synapsen, „Lautstärkeregler“ im Rückenmark, Gehirnnetzwerke und vor allem: Neuroplastizität.
Die Kernbotschaft dahinter: Schmerz ist kein exakter Gewebescanner. Denn zwischen Gewebebeschaffenheit und Aua steht das Nervensystem.
Das Nervensystem bewertet Bedrohung – basierend auf Gewebe, Erfahrungen, Gedanken, Stress, Angst usw. – und entscheidet dann, wie laut es „Aua!“ schreit. Und dieses System ist lernfähig und damit veränderbar.
Über alle Studien hinweg zeigt das Review ziemlich klar:
- Wenn Menschen verstehen, was im Nervensystem passiert,
- und begreifen, dass Sensitivität nicht gleich Gewebeschaden ist,
dann passiert Folgendes:
- Schmerzen gehen runter,
- Behinderung/Funktionsverlust nimmt ab,
- Katastrophisieren und Angst vor Bewegung werden weniger,
- Bewegung und körperliche Leistungsfähigkeit verbessern sich.
Und auch hier: Gleichgebliebene Strukturen, aber das Nervensystem lernte, sie anders zu bewerten und die Muskulatur/Kompensationsmuster anders zu steuern. Wenn also der „Gefahren-Alarm“ im Nervensystem heruntergeregelt wird, kann ein verängstigtes Nervensystem umprogrammiert werden – und damit Schmerz, Stress und Funktionsstörungen verbessern, selbst wenn die Struktur sich nicht ändert.
Und genau deshalb ist es möglich, hypermobile Kopfgelenke zu haben und trotzdem symptomfrei zu sein, so, wie ich es erlebe. Biomechanik ist eben nur ein Teil der Medaille. Regulation, also welche Muskeln wann wie anspannen, wie Bänder neuromuskulär unterstützt werden, wie Bewegungen eingeschränkt oder freigegeben werden, ist 100 % Nervensache.
Ursuppe und der Kern der Sache nochmal anders: Es geht ums Tuning
Dass ein „ruhiges“ Nervensystem Kompensation steuert, taucht in der Sensorimotorik-Forschung immer wieder auf. Treleaven (2008) zeigt zum Beispiel, dass sowohl direkte Störungen der Rezeptoren (Trauma, Ischämie, Entzündung, muskulärer Umbau) als auch Stress das Muster ankommender Informationen verändern können, sodass das System in einen hypervigilanten, „lauten“ Zustand rutscht. Die Folge ist aber nicht einfach „mehr Schmerz“, sondern ein verändertes Tuning der gesamten Sensorimotorik. Das Nervensystem kompensiert also nicht mehr elegant, sondern reagiert überzogen, ungenau oder vermeidend.
Und das passt ziemlich gut in meine ganz eigenen Überlegungen, die die Grundlage meiner Heilung waren: Das Nervensystem „leidet“ nicht nur, wenn Instabilität da ist, sondern ist immer noch aktiv lernfähig. Es kann zum Beispiel lernen, dass bestimmte Bewegungen oder Behandlungen sicher sind, und damit entsteht die Grundlage für neue Kompensationsstrategien.
Und jetzt Schluss: Entspannt euch endlich!
Wer nun immer noch glaubt, Entspannung sei bloß „nice to have“, hat das System nicht verstanden. Er hat nicht verstanden, dass nicht die Muskeln zuerst stabilisieren. Und auch nicht die Bänder. auch nicht die Therapie von außen. Sondern das Nervensystem.
Deshalb reicht reine HWS-Muskelarbeit oft nicht. Deshalb gehen viele Behandlungen nach hinten los. Deshalb können instabile Wirbel allein nicht erklären, warum Symptome explodieren oder verschwinden. Ein Nervensystem im Alarmmodus blockiert sinnvolle Kompensationen, sodass selbst gut trainierte Muskeln nicht richtig arbeiten können! Es interpretiert jede minimale Instabilität als drohende Katastrophe und erzeugt Symptome, die schlimmer sind als die anatomische Lage. Und es weht sich gegen Therapieversuche, weil es nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheiden kann.
Entspannung und somit die Senkung des Bedrohungsempfindens ist also kein esoterischer Kram, sondern eine essentielle neurophysiologische Säule:
- Weniger sympathischer Stress = bessere Muskelansteuerung
(Passatore & Roatta, 2006): Der Sympathikus greift direkt in die Muskelspindelregulation ein. Bei erhöhtem Stress feuern Muskelspindeln unpräzise und „überdreht“. Das zentrale Nervensystem erhält Rauschen statt Signale. Kompensationsmuskeln regulieren schlechter. Das ist die physiologische Brücke zwischen Nervensystem regulieren und Stabilität verbessern.
Ein Gedanke zum Abschluss kommt mir gerade: CCI ist eigentlich wie Pubertät, nur ohne Pickel.
CCI ist wie Pubertät: Der Chef im Kontrollraum ist überfordert – und alles gerät ins Chaos
Wisst ihr, was Pubertät bedeutet? Der Präfrontalcortex, der Chef im Gehirn, zuständig für Planung, Überblick, Impulskontrolle, Filtern von Körpersignalen, Aufmerksamkeit, Emotionsregulation usw. wird umgebaut. Und während der Chef außer Gefecht ist, muss vorübergehend das limbische System einspringen. Nur ist das für Krisenmanagement ungefähr so geeignet wie eine Operndiva im Escape Room: es fühlt viel, es übertreibt viel, es reagiert impulsiv – aber sinnvoll führen kann es nicht.
Bei CCI passiert biologisch etwas Ähnliches:
Die neurophysiologischen Kontrollsysteme, die normalerweise Stabilität, Propriozeption, Augensteuerung und Gleichgewicht souverän managen, sind überfordert, überlastet oder von chaotischen ankommenden Informationen überflutet. Der „Chef“ der Körpersteuerung – dein zentrales Nervensystem – ist nicht verfügbar oder total gestresst.
Und wer übernimmt? Die Alarm- und Schutzsysteme. Und auch sie sind reine Drama-Queens. Sobald aber die Chefetage wieder aktiv wird und klare, gefilterte Signale eintrudeln können, beruhigt sich der Laden. Die Systeme reifen nach, stimmen sich neu ab, kompensieren sauberer und das Chaos ebbt ab.
Schön, oder? Und jetzt ’ne Folge Sailor Moon.
Barrett, L. F. (2017). How Emotions Are Made: The Secret Life of the Brain. Houghton Mifflin Harcourt.
Brinjikji, W., Luetmer, P. H., Comstock, B., Bresnahan, B. W., Chen, L. E., Deyo, R. A., Halabi, S., Turner, J. A., Avins, A. L., James, K., Wald, J. T., Jarvik, J. G., & Kallmes, D. F. (2015). Systematic literature review of imaging features of spinal degeneration in asymptomatic populations. AJNR: American Journal of Neuroradiology, 36(4), 811–816. https://doi.org/10.3174/ajnr.A4173
Enix et al. (2014). The cervical myodural bridge, a review of literature and clinical implications. The Journal of the Canadian Chiropractic Association, 58(2), 184–192.
Ghori, A. K., Leonard, D., & Cha, T. (2012). Biomechanics of the cervical spine: From the normal state to the injury state. Seminars in Spine Surgery, 24(4), 196–206. https://doi.org/10.1053/j.semss.2012.05.006
Jull, G., Falla, D., Treleaven, J., Hodges, P., & Vicenzino, B. (2007). Retraining cervical joint position sense: The effect of two exercise regimes. Journal of Orthopaedic Research, 25(3), 404–412. https://doi.org/10.1002/jor.20220
Le Pera, D., Graven-Nielsen, T., et al. (2001). Inhibition of motor system excitability at cortical and spinal level by tonic muscle pain. Clinical Neurophysiology, 112(9), 1633–1641.
Louw, A., Diener, I., Butler, D. S., & Puentedura, E. J. (2011). The effect of neuroscience education on pain, disability, anxiety, and stress in chronic musculoskeletal pain: A systematic review. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 92(12), 2041–2056. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2011.07.198
Panjabi M. M. (1992). The stabilizing system of the spine. Part I. Function, dysfunction, adaptation, and enhancement. Journal of spinal disorders, 5(4), 383–397. https://doi.org/10.1097/00002517-199212000-00001
Passatore, M., & Roatta, S. (2006). Influence of sympathetic nervous system on sensorimotor function: Whiplash-associated disorders (WAD) as a model. European Journal of Applied Physiology, 98(4), 423–449.
Treleaven, J. (2008). Sensorimotor disturbances in neck disorders affecting postural stability, head and eye movement control. Manual Therapy, 13(1), 2–11.
Wood, J., Varley, T., Hartman, J., Melia, N., Kaufman, D., & Falor, T. (2025). A mechanical basis: Brainstem dysfunction as a potential etiology of ME/CFS and long COVID [Preprint]. Preprints.org. https://doi.org/10.20944/preprints202506.0874.v1

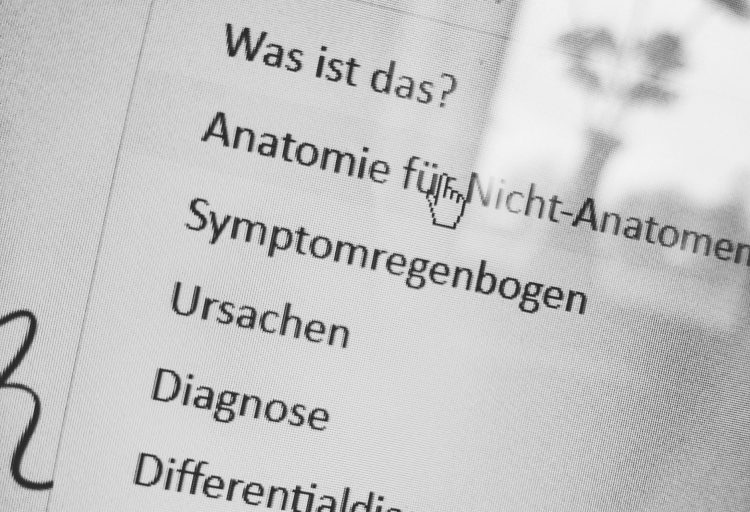
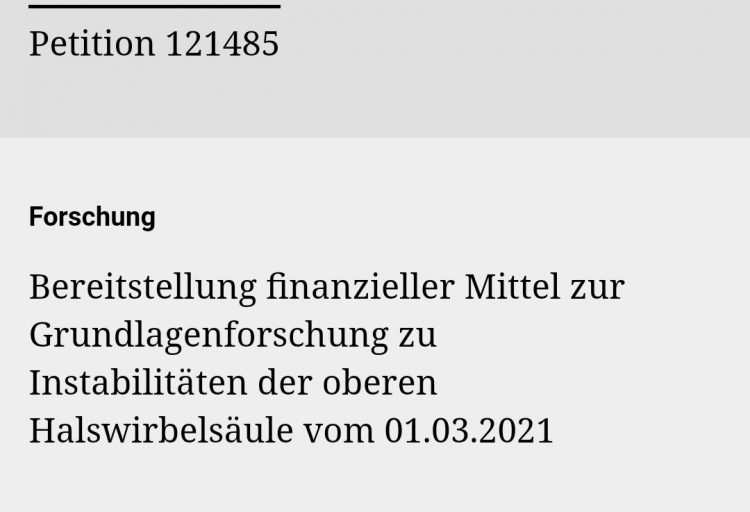

Leave a Reply