Noch immer bin ich dankbar für alles, was ich bis jetzt erleben durfte – ob Gutes oder Schlechtes. Selbst meiner Erkrankung kann ich etwas Positives abgewinnen, zum Beispiel meinen geschärften Sinn für den Zauber eines Teebeutels.
Teebeutel und Armseligkeit
Habt ihr das mal beobachtet? Wie ein Teebeutel in heißem Wasser bunte Farbwolken nach sich zieht? Ich staune jedes Mal darüber, obwohl es von außen betrachtet wahrscheinlich ziemlich schräg rüberkommt.
Und deshalb ist mir an manchen Tagen nach Weinen.
Ich denke dann: „Wie armselig ist es, sich über einen Teebeutel zu freuen? Ist mein Leben wirklich so verkommen?“
Aber es wundert mich nicht, dass ich so denke. Ich bin ganz einfach müde, weil mein Körper sich so schwer anfühlt. Weil er mich beschränkt, mir kein bisschen Urlaub gönnt. Ist es denn wirklich so unmöglich? Alles, was ich will, ist doch nur gesund sein. Damit ich mich endlich entfalten kann. Doch vielleicht ist es ja andersrum…
Hoffnung existiert woanders
Es geht mir besser als in längst vergangenen Zeiten, zugegeben, doch noch immer schlecht genug, um hin und wieder melancholisch zu werden. Dann bete ich und weine, weil ich um nichts in der Welt zum Ballast meiner Familie werden möchte.
Hinterher denke ich wieder positiv und ich frage mich: Was spricht denn dagegen, dass ich vollständig heile? Logik? Vernunft? Von denen muss ich mich endgültig verabschieden, denn Hoffnung existiert woanders. Ohne Hoffnung keine Heilung. So einfach ist das.
Und Weinen gehört dazu. Jeder chronisch Kranke weint dann und wann – nichts, was einen ärgern müsste. Ehrlich gesagt fühlt sich Weinen für mich wie ein kurzer Moment des Loslassens an, in dem ich mir vorstelle, dass das Universum nur darauf wartet, mir meine Gesundheit zurückzugeben. „Greif zu!“, ruft es und lächelt mir zu. Na dann… Worauf warte ich eigentlich?



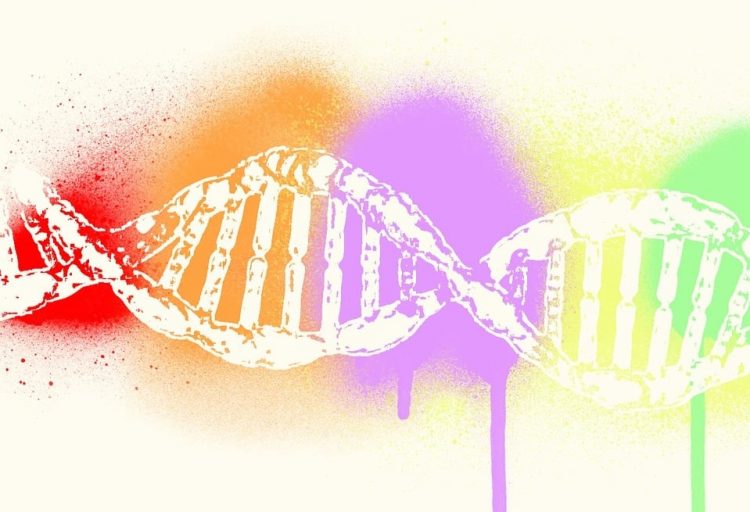
Leave a Reply